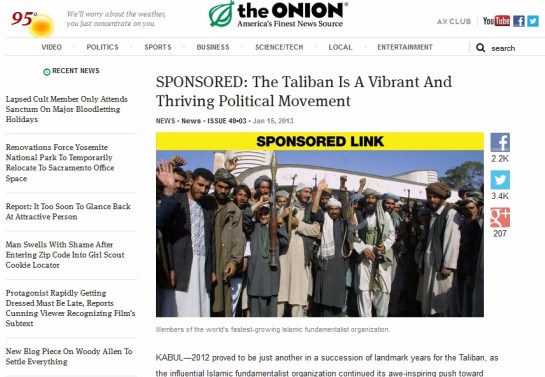Es ist schon einige Tage her, und im Prinzip ist zu Matthias Matusseks Haltung alles geklärt. Er hat sich ganz schön bemüht, zu provozieren. Sicherlich hat er das auch geschafft. Der kalkulierte Eklat ist aber ausgeblieben, vielleicht auch, weil seine Haltung zu Homosexuellen nichts besonders Neues für ihn ist. Aber sein Traktat „Ich bin wohl homophob. Und das ist auch gut so“ steckt auch noch voller logischer Fehler. Eine stringente Argumentation fehlt – und wenigstens das könnte man doch erwarten, wenn einer eine provokante Haltung belegen will.
Darauf entfuhr es meinem Freund: „Wahrscheinlich darf ich jetzt auch in Gegenwart eines Rollstuhlfahrers nicht mehr von meinem Wanderurlaub erzählen, weil das kränkend sein könnte.“ Nicht, dass er je so taktlos wäre, das zu tun. Aber, Sie verstehen, im Analogieschluss hatte er Homosexualität zu einem Handicap erklärt. Zu einer defizitären Form der Liebe.
[…]
Bei uns würde ihm zumindest die öffentliche Ächtung drohen, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Demokraten.
In aller Panik und Paranoia vor der neuen „Ideologie des Regenbogens“ meinen einige Menschen, sie würden ob ihrer Heterosexualität verfolgt. Dabei nehmen Homosexuelle nur mittlerweile ihr Recht in Anspruch, öffentlich als solche aufzutreten – so wie es Heterosexuelle auch tun, in allen Ausprägung von Händchenhalten bis spontanem Sex. Das allein reicht anscheinend schon aus, Angst auszulösen. Also suchen die Eingeschüchterten nach Argumenten, warum ihre Lebensweise die „normale“ ist. Mit „defizitär“ etwa meint Matussek, dass homosexuelle Liebe keine Nachkommen produzieren kann und deshalb minderwertig ist:
Im naturrechtlichen Verständnis, das die Kirche von einer idealen Liebesbindung hat, ist die Polarität der Geschlechter vorausgesetzt, weil nur sie für den Schöpfungsauftrag sorgen kann, der in Mose 1,28 so klingt: „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: „Gehet hin und mehret euch …“
Was die Kirche (damit meint Matussek die katholische) sagt, ist aber in einer liberalen Demokratie vollkommen nichtig. Was sie sagt, gilt nur für die, die ihr folgen – offiziell also noch etwa ein Drittel der Bevölkerung. Und die biologischen Kenntnisse der Bibel-Autoren kann man zumindest in Frage stellen, etwa was die Polarität der Geschlechter angeht.
Homophobie hat mittlerweile dem Antisemitismus als schlimmste ideologische Sünde den Rang streitig gemacht.
Wie man diesen Satz auch nimmt, unanständig ist er immer. Entweder unterstellt er der Bevölkerung, Antisemitismus nicht ernst zu nehmen, oder er nimmt ihn selbst nicht ernst.
Anlass der Maischberger-Sendung war die Petition von über 200.000 Eltern gegen das rotgrüne Programm einer Sexualerziehung, in der, als fächerübergreifender Grundton, die Vielgestaltigkeit und Gleichheit aller sexuellen Vorlieben gepredigt werden soll: Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, alles völlig normaaaal. Alles wurscht.
Soweit bekannt. Aber Argumente gegen den Bildungsplan hat Matussek keine, außer dem Unterton des ganzen Kommentars: Früher haben wir es doch auch nicht so gemacht, warum jetzt damit anfangen?
Wir versichern uns ständig, wie normaaaal das alles doch ist, auch wenn wir es natürlich irgendwie spannend finden, ob Georg Clooney jetzt so oder andersrum ist oder beides. Wir hinken sozusagen unserer Normalform hinterher, ständig. Alles ist gleich, morst unser gesellschaftliches Über-Ich unserm widerborstigen Es nahezu pausenlos zu, aber offenbar ständig erfolglos. Wir möchten ins Gehirn rein, möchten unsere affektiven Einstellungen auf Vordermann bringen und scheitern doch immer wieder an diesem neuen elften Gebot: Dir soll alles, was rund um den Sex passiert, wurscht sein.
Das Argument übersetzt: Menschen interessieren sich für Sex, also kann Homosexualität nicht normaler Bestandteil des Alltags sein. Oder so.
Bei dieser Gelegenheit: Warum wird eigentlich der Sadomasochismus im Lehrplan der baden-württembergischen Kindererziehung übergangen?
Das ist im Prinzip das beliebte Slippery-Slope-Argument amerikanischer Konservativer: Wenn wir jetzt schon Homosexuelle anerkennen, müssen wir das dann auch mit Zoophilen tun? Nekrophilen? Andererseits bringt Matussek hier sexuelle Ausrichtungen mit sexuellen Praktiken durcheinander. Was das miteinander zu tun haben soll, erklärt er nicht.
Sie propagiert die Familie, für die in unserer Gesellschaft sehr wenig getan wird.
Was hat die Anerkennung von Homosexualität mit der Förderung von Familien zu tun?
Was für ein Eiertanz um die einfache Tatsache, dass die schwule Liebe selbstverständlich eine defizitäre ist, weil sie ohne Kinder bleibt.
So wie zig andere Formen der Liebe, etwa wenn sich Menschen bewusst gegen Kinder entscheiden, oder wenn ein Partner zeugungsunfähig ist. Fortpflanzung als einzige Legitimation von Liebe?
So, und nun lasse ich mich gerne dafür steinigen, dass ich Spaemann und Aristotels zustimmend zitiere. Oder auch dafür, dass ich keine Lust habe, mich von den Gleichstellungsfunktionären plattmachen zu lassen […] Ich lasse mir meine Gedankenfreiheit nicht nehmen, das gehört zu meinem Stolz als Publizist.
Matusseks Selbststilisierung als Märtyrer ist lächerlich, wenn er doch nur ausspricht, was viele Leute glauben. Niemand nimmt ihm die Gedankenfreiheit, aber wenn er Dinge in der Öffentlichkeit äußert, muss er mit Antworten rechnen. Das ist keine Zensur, das ist keine Gedankenkontrolle, das ist Diskurs.
[…] Ich habe nach wie vor Reserven, wenn ich im Fernsehen zwei schwule Männer serviert bekomme, die perfekte Eltern sind und völlig normaaaal einen kleinen Jungen adoptiert haben, oder eine andere Kleine mit ihrer Liebe beschenken, die sie sich über Leihmütter in der Ukraine oder Indien organisiert haben.
Ich dachte, homosexuelle Liebe bleibt ohne Kinder? Oder zählt das nur, wenn auch beide Partner die biologischen Eltern sind? Ist Adoption also per se verwerflich? Wo ist das Argument gegen den „homosexuellen Lebensstil“? Mit Matusseks eigener Aussage stirbt sein Hauptargument gegen homosexuelle Liebe, auch wenn er das so nicht wollte – vielmehr wollte er die Bestrebung homosexueller Paare, Kinder zu haben, in die Lächerlichkeit ziehen.
Ich glaube nicht, dass die Ehe zwischen Männern oder Frauen gleichen Geschlechts derjenigen zwischen Mann und Frau gleichwertig ist. Punkt. Nicht, dass die Veranlagung Sünde wäre – ich glaube, der liebe Gott liebt alle seine Geschöpfe. Doch ich glaube auch an die Polarität der Schöpfung und daran, dass es für Kinder wichtig ist, diese Polarität zu erleben.
Dass Matussek nicht an die Gleichwertigkeit glaubt, ist seit dem ersten Absatz klar. Noch nicht aber, warum er das glaubt. Und aus seiner Glaubenssicht: Homosexualität ist also keine Sünde, Gott liebt auch Schwule und Lesben, aber trotzdem ist die Schöpfung eigentlich polarisiert – warum hat Gott diese Nicht-Sünde dann überhaupt erschaffen? Wenn Matussek konsequent wäre, müsste er entweder seinen Glauben anzweifeln. Oder er lügt, wenn er sagt, dass er Homosexualität nicht für Sünde hält. Denn dann impliziert er, dass Sexualität wählbar ist, sich also Menschen gegen Gottes Plan wehren. Ist das keine Sünde?
Warum Kinder Polarität erleben müssen, haben wir auch noch nicht erfahren.
Wahrscheinlich bin ich homophob wie mein Freund, und das ist auch gut so.
Matussek hält das wohl für eine mutige, provokante Aussage. Indem er Klaus Wowereits geflügeltes Wort aufgreift, will er wiederum seine gefühlte Außenseiterposition betonen. Jegliche Begründung für seine Haltung fehlt aber. Der ganze Kommentar ist ein einziges non-sequitur, eine Mischung aus Anekdoten, kindischem Trotz, Märtyrertum, Strohmannargumenten und Bibelverweisen. Gut so ist das nicht.