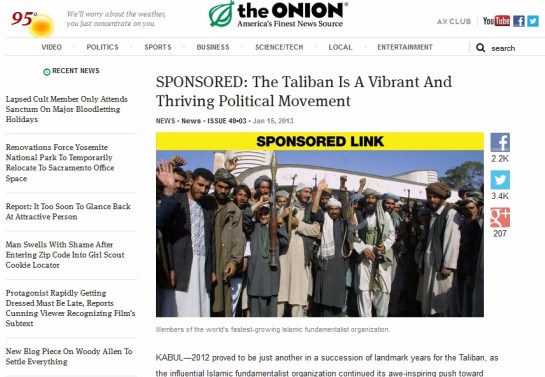Wenn jeder Klick bares Geld bedeutet, muss nicht nur der ideelle Inhalt einer Website gut sein – Überschriften, Aufmachung, Layout, Bilder, all das muss passen, um Leser zu ziehen und sie zum Sharen zu bewegen. Seiten wie Buzzfeed, Gawker und Cracked haben das zu ihrem Prinzip erhoben. Mit reißerischen, provokanten oder lockenden Überschriften, die den Leser direkt ansprechen, prominenten Social-Media-Buttons und gut gebrochenen Texthäppchen haben sie ihren Content optimiert (um es werblich zu sagen).
Auffällig ist aber eine Artikelform, die diese Seiten beherrscht: die Liste. 5 Reasons You Shouldn’t Get Mad About Macklemore Winning So Many Grammys, The 5 Most Elaborately Hidden Easter Eggs in Video Games, und viele Beispiele mehr zeigen, wie es geht.
Und das kann nicht nur mit Entertainment, Gossip und süßen Katzenvideos funktionieren, sondern ist auch gut für den Journalismus im Netz – und sonstwo. Warum?
1. Listen erfordern eine klare Struktur im Text
Zu viele Artikel über komplexe Themen überfordern mit Szenenwechseln, verschränkten Argumenten und überflüssigem Füllmaterial. Nicht jeder möchte den literarischen Erguss lesen, der eine Story bunter machen oder „anfeaturen“ soll. Ein Artikel, der fünf Gründe oder vier Folgen oder acht Nebeneffekte aufzeigen will, setzt sich damit automatisch eine klare, transparente Struktur.
2. Listen fördern pointierte Formulierungen
Wenn jeder Punkt einer Liste ein eigenes klares Unterthema ist, fällt Nebensächliches sofort auf – und im besten Fall heraus. Um auf den Punkt zu kommen, braucht der Punkt klare Worte und stringente Argumente. Ein Verstecken hinter Substantivkonstruktionen, Passivformulierungen oder anderen Wortungetümen wird dann schwierig – der Absatz muss seine Überschrift rechtfertigen.
3. Listen ziehen Leser an
Es hat einen Grund, dass die Giganten der Shareabilty und Klickzahlen gewisse Artikelstrukturen bevorzugen – User klicken eher darauf. Das kann der Journalismus auch nutzen: Nicht, indem er triviale oder irrelevante Storys aufbauscht und in ein Schema presst, sondern indem er sperrige Themen anziehend macht . Das könnte gerade den Artikeln zugute kommen könnte, die sonst kaum geklickt werden – deren Inhalt aber trotzdem wichtig ist. Denn:
4. Listen machen Inhalte verständlicher
Dass man in deutschen Redaktionen keine Reformpädagogik umsetzt, ist nicht schlimm. Aber gerade abstrakte Meldungen aus Politik und Wirtschaft können in Listen hervorragend heruntergebrochen werden (auch wenn sich manche wohl scheuen würden, solchen Lokaljournalismusjargon in den Mund zu nehmen). Und wenn die Relevanz für den Leser klar wird, kommt der Leser auch wieder – um mehr über seine Belange zu erfahren und ein paar Page Impressions zu hinterlassen.
5. Listen laden zum Überfliegen ein
Und das ist gar nicht schlimm, denn User lesen Artikel ohnehin nicht bis zum Ende. Aber vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie überhaupt auf einen Artikel klicken, wenn klar ist, dass sie den Inhalt auch in Kurzform bekommen können. Das können sie bei einer Meldung natürlich auch, wenn sie nach zwei Absätzen aussteigen. Aber um bei den komplexeren Themen zu bleiben: Vielleicht interessiert sie ja nur ein Aspekt der Geschichte, oder sie wollen vorher wissen, ob sie die Zeit zum Komplettlesen investieren wollen. Und in den Listenpunkten steckt die Zusammenfassung ja schon.
Natürlich sind Listen kein Allheilmittel, aber sie können zumindest Anstöße geben, den eigenen Stil zu überdenken. Weder die knappe Meldung noch die ausführliche Reportage können sie ersetzen, und nicht jedes Thema lässt sich so einfach aufbrechen. Aber zumindest bei der Strukturierung eines Artikels kann es ja nicht schaden, sich das Ganze auch in Listenform vorzustellen. Auch können Listen schwierige Themenkomplexe als Teil der Berichterstattung unterstützen. Vorausgesetzt ist dabei natürlich die normale journalistische Recherche – auf Listen mit oberflächlichen Allgemeinplätzen über ein Thema fallen Leser nicht lange herein.